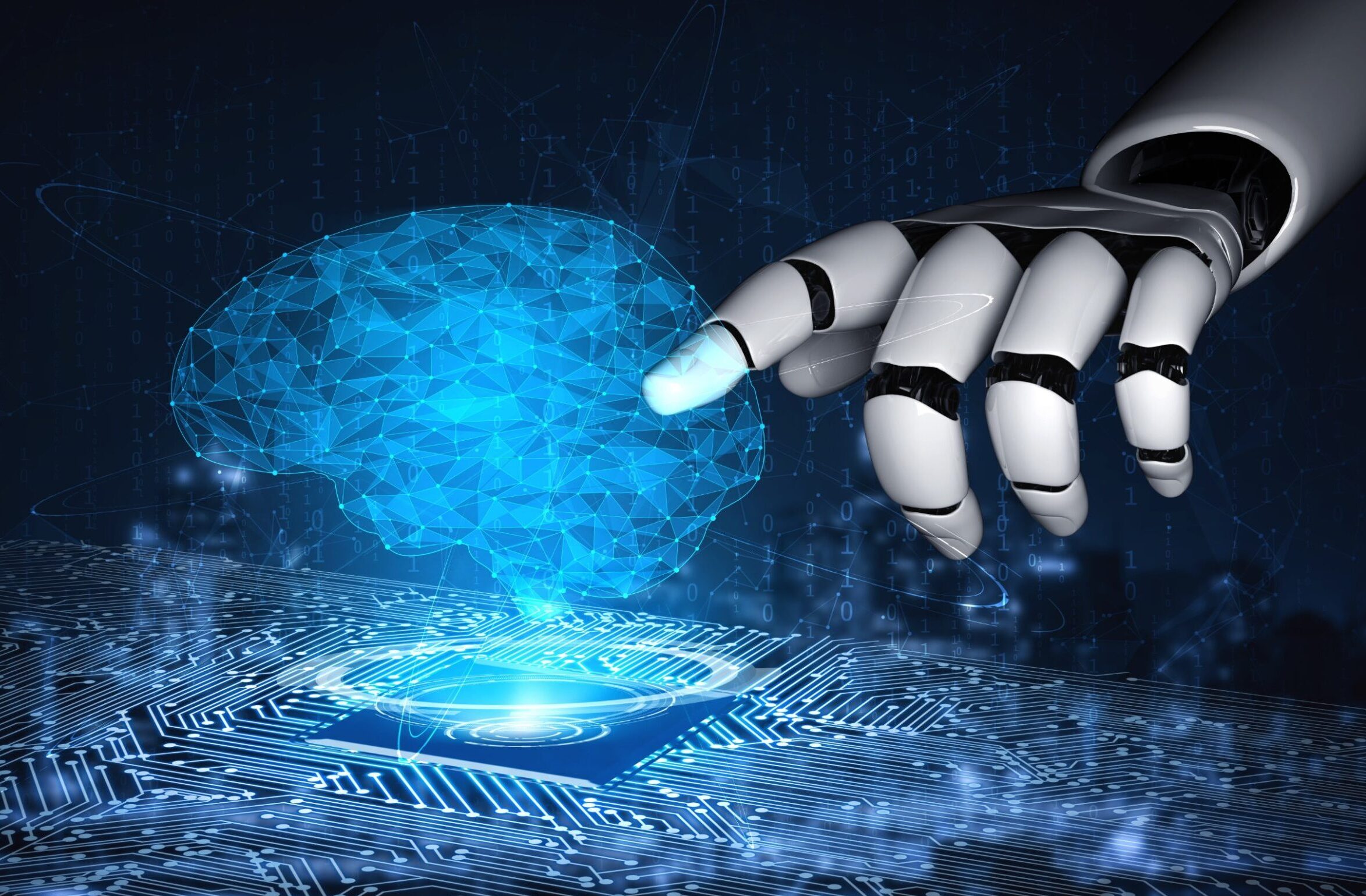Beschäftigte in deutschen Unternehmen stehen dem Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) überwiegend positiv entgegen. 49 % blicken mit Neugier darauf, wie KI ihre Arbeit verändern wird (global: 50 %), 26 % empfinden sogar Vorfreude (global: 41 %). Dennoch zeigt sich: Die tatsächliche Nutzung bleibt hinter den Erwartungen zurück. Weniger als die Hälfte der Mitarbeitenden haben im vergangenen Jahr tatsächlich mit KI gearbeitet (global: 54 %). Besonders auffällig ist die geringe Nutzungsintensität – lediglich 9 % setzen generative KI täglich ein, 15 % wöchentlich. Gründe für die zurückhaltende Nutzung liegen nicht in mangelnder Technik, sondern in fehlenden Kompetenzen, unklaren Anwendungsfällen und zu wenig Unterstützung durch Führungskräfte. Das zeigt die Studie „Global Workforce Hopes and Fears 2025“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, für die weltweit knapp 50.000 Beschäftigte befragt wurden.
Wer hierzulande bereits mit generativer KI arbeitet, berichtet von deutlichen Verbesserungen. 65 % sagen, dass GenAI ihre Arbeitsqualität verbessert hat, 58 % waren dank der Technologie kreativer und 62 % erhöhten ihre Produktivität. Diese positiven Erfahrungen bestätigen die Erwartungen aus dem Vorjahr: Damals gingen fast zwei Drittel der Arbeitnehmenden davon aus, dass GenAI ihre Arbeitszeit in den folgenden 12 Monaten effizienter machen würde.
Wie im Vorjahr: Wandel bleibt eine Konstante
Die KI-Nutzung ist Teil eines größeren Bildes: Unternehmen und ihre Mitarbeitenden befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel. Für die Mehrheit sind technologische Veränderungen (43 %), neue Kundenpräferenzen (42 %) sowie staatliche Regulierung (41 %) die stärksten Treiber für Veränderungen. Der Einfluss des Klimawandels wird dagegen nur noch von 30 % wahrgenommen – ein Rückgang gegenüber 2024.
35 % glauben, dass sie in den nächsten drei Jahren großen oder sehr großen Einfluss darauf haben, wie Technologie ihre Arbeit verändert (global: 40 %), 16 % fühlen sich hingegen komplett machtlos. Das deutet darauf hin, dass technologische Transformation in vielen Unternehmen noch nicht als gemeinsamer, gestaltbarer Prozess wahrgenommen wird.
Positive Grundstimmung trifft auf Wechselbereitschaft
Der permanente Wandel hinterlässt Spuren – auch bei der Bindung ans Unternehmen. Trotz positiver Grundstimmung droht eine ausgeprägte Talentmobilität, die die Innovationskraft nachhaltig gefährdet. Aktuell sind mehr als drei Viertel stolz auf ihren Job und 63 % betrachten ihre Aufgaben als sinnvoll. Zudem freuen sich 70 % der Beschäftigten auf ihre Arbeit – mehr als im globalen Schnitt (64 %). Die positive Einschätzung ist damit im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen: 2024 äußerten 62 %, dass sie sehr oder mäßig zufrieden sind. Es zeigt sich aber auch: 22 % der Befragten erwägen in den nächsten zwölf Monaten einen Jobwechsel (global: 24 %) und 24 % ziehen eine Bewerbung auf neue Stellen in Betracht – im globalen Durchschnitt sind es 27 %.
Die Gründe für die Wechselbereitschaft sind vielfältig. 41 % der Mitarbeitenden fühlen sich mindestens einmal pro Woche erschöpft, ebenso viele fühlen sich regelmäßig überfordert. Hinzu kommt die fehlende finanzielle Anerkennung: Nur 37 % der deutschen Beschäftigten haben im vergangenen Jahr eine Gehaltserhöhung erhalten – im globalen Durchschnitt waren es 43 %. Die Bedeutung fairer Bezahlung bestätigen die Vorjahreszahlen: 87 % der Arbeitnehmenden gaben 2024 an, dass dies wichtig für sie ist – sogar mehr als Faktoren wie Flexibilität oder eine erfüllende Tätigkeit.
Vertrauen als entscheidender Motivationsfaktor
Neben finanziellen Anreizen ist Vertrauen ein entscheidender Hebel, um Mitarbeitende stärker zu motivieren und zu binden – gerade in Zeiten des schnellen Wandels. Entscheidend ist, dass Führungskräfte den Wandel erklären, eine klare Richtung vorgeben, Entwicklung aktiv fördern und ihre Mitarbeitenden motivieren.
Viele Unternehmen in Deutschland haben bereits eine solide Vertrauensbasis zur Führungsebene aufgebaut: 63 % der Beschäftigten können offen mit ihrer direkten Führungskraft sprechen (global: 59 %). Das Vertrauen ins Top-Management hingegen ist ausbaufähig: Mit 47 % liegt es unter dem globalen Mittel (51 %) und nur 52 % trauen der Führung zu, die langfristigen Unternehmensziele zu erreichen.
Auch bei der Innovationskultur zeigt sich Nachholbedarf: Während sich weltweit 56 % der Beschäftigten trauen, im Team neue Ideen auszuprobieren, sind es in Deutschland nur 51 %. Eine gelebte Fehlerkultur ist global bei 54 % verbreitet, hierzulande bei etwas weniger als der Hälfte (49 %).
Kompetenzaufbau braucht mehr Unterstützung
Lücken sind auch bei der Kompetenzentwicklung erkennbar und bremsen das Potenzial. Nur 55 % der deutschen Mitarbeitenden haben Zugang zu den Lern- und Weiterbildungsressourcen, die sie benötigen – im globalen Durchschnitt sind dies 59 %. Außerdem haben lediglich 48 % der Beschäftigten im vergangenen Jahr karrierefördernde Fähigkeiten erworben (global: 56 %), und nur 53 % fühlen sich von ihrem Vorgesetzten beim Kompetenzaufbau unterstützt (global: 57 %).
Alles in allem ist ein Großteil der Befragten (59 %) zuversichtlich, was die Zukunft der eigenen Rolle im Unternehmen angeht (global: 53 %).
(PwC vom 17.11.2025 / RES JURA Redaktionsbüro – vcd)