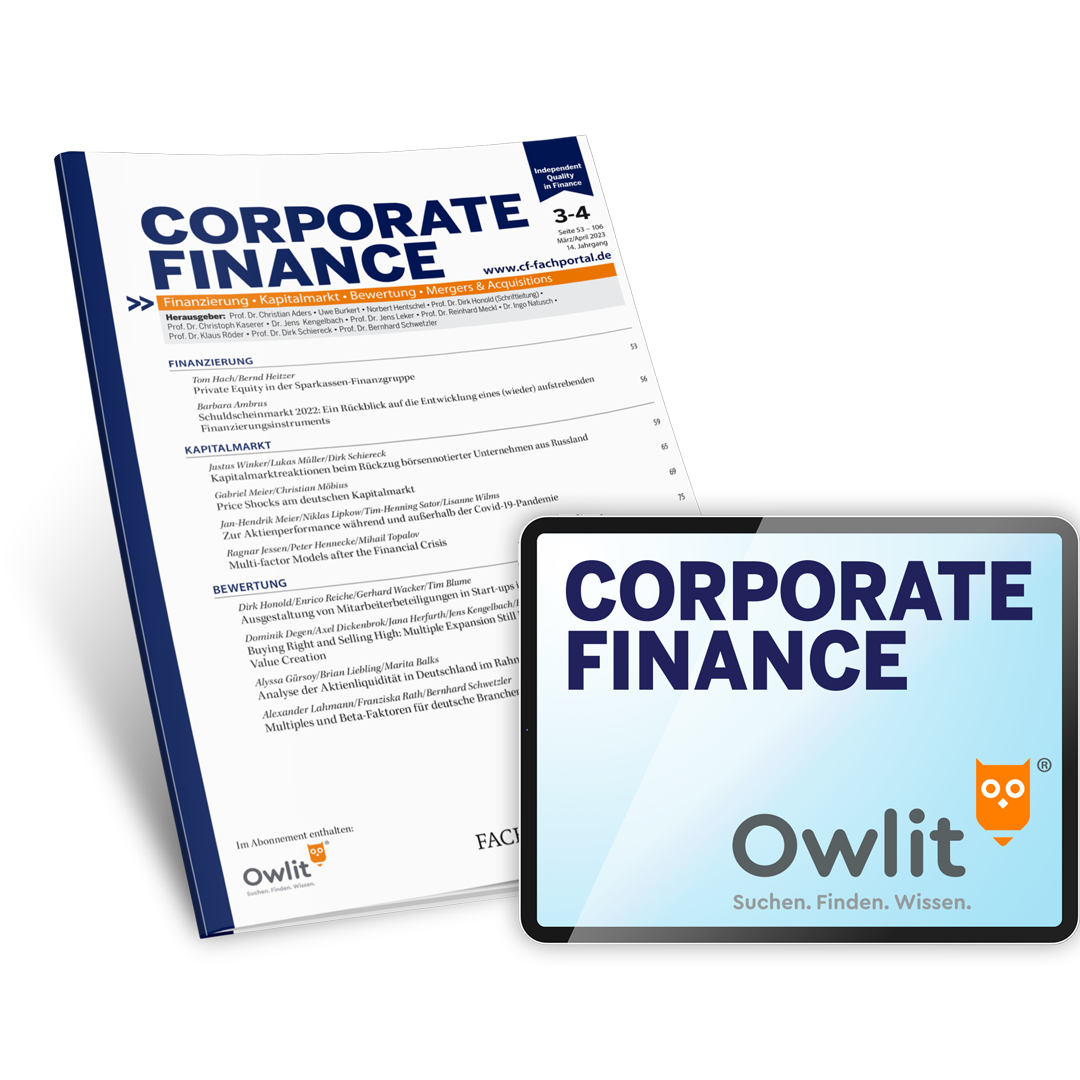Der Sachverständigenrat Wirtschaft erwartet für 2023 einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 0,4 % und für 2024 ein Wachstum von 0,7 %. Die Inflationsrate wird voraussichtlich in diesem Jahr 6,1 % betragen, im kommenden Jahr 2,6 %.
Die Energiekrise und gesunkene Realeinkommen belasten immer noch die kurzfristige wirtschaftliche Entwicklung. Mittelfristig bremsen aber vor allem das sinkende Arbeitsvolumen, der veraltete Kapitalstock und fehlende innovative Unternehmen das Wachstum in Deutschland. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten sind dadurch auf einem historischen Tiefstand. „Um die Wachstumsschwäche zu überwinden, muss Deutschland in seine Zukunft investieren. Dafür sind stärkere Produktivitätsfortschritte durch Innovationen, Investitionen und mehr Dynamik bei Unternehmensgründungen notwendig. Diese können das sinkende Arbeitsvolumen teilweise kompensieren. Gleichzeitig sind Reformen im Steuer-Transfer-System und im Rentensystem dringend erforderlich“, sagt Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft. Wie dies konkret gelingen kann, diskutiert der Sachverständigenrat im Jahresgutachten.
Die konjunkturelle Erholung verzögert sich
Die Konjunktur wird noch immer von der Energiekrise und den durch die hohe Inflation gesunkenen Realeinkommen gebremst. Um die Inflation zu bekämpfen, haben die Zentralbanken weltweit ihre Geldpolitik gestrafft. Die Straffung und die schleppende Entwicklung in China tragen zum eingetrübten außenwirtschaftlichen Umfeld bei. Das höhere Zinsniveau dämpft zudem Investitionen und Bautätigkeit im Inland. Der Sachverständigenrat erwartet daher, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % schrumpft. Im Jahr 2024 ist aufgrund steigender Realeinkommen mit einer Ausweitung des privaten Konsums zu rechnen. Dies dürfte zu einer verhaltenen konjunkturellen Erholung führen und das BIP um 0,7 % erhöhen.
Kerninflation bleibt erhöht
Die Inflationsrate hat sich seit Jahresbeginn 2023 etwa halbiert. Wegen eines starken Preisdrucks zum Jahresanfang 2023 dürften die Verbraucherpreise im Jahresdurchschnitt aber noch um 6,1 % steigen. Während die Preissteigerungen bei Energie und Nahrungsmitteln deutlich abnehmen, dürfte die Kerninflation auch im kommenden Jahr erhöht bleiben. Dies liegt unter anderem an den stark gestiegenen Lohnstückkosten, die zu anhaltenden Preissteigerungen bei Dienstleistungen führen dürften. Für das Jahr 2024 prognostiziert der Sachverständigenrat daher eine Inflationsrate von 2,6 %.
Deutliche Wachstumshemmnisse für die kommenden Jahre
Die deutsche Volkswirtschaft weist seit Beginn der Corona-Pandemie das geringste BIP-Wachstum im Euro-Raum auf. „Viel bedeutsamer als die konjunkturelle Schwäche sind die mittelfristigen Wachstumshemmnisse für das Produktionspotenzial“, sagt Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft. Gemäß der Mittelfristprojektion des Sachverständigenrats wird das Produktionspotenzial bei Fortschreibung bestehender Dynamiken bis zum Jahr 2028 jährlich nur um durchschnittlich 0,4 % wachsen. Dies wäre ein historischer Tiefstand, der insbesondere auf das sinkende Arbeitsvolumen zurückzuführen ist. Um das Potenzialwachstum wieder spürbar zu erhöhen, müssten die Investitionstätigkeit gesteigert und der Rückgang des Arbeitsvolumens verlangsamt werden. „Stärkere Erwerbsanreize, eine ambitionierte Zuwanderungspolitik, verbesserte Schulbildung und eine Stärkung der Universitäten sind entscheidend. Zugleich gilt es, den Strukturwandel zuzulassen und Investitionen zu mobilisieren, die die Produktivität steigern“, erläutert Veronika Grimm. Investitionen in Kapitalgüter wie Maschinen, Roboter und Informationstechnologie können die gesamtwirtschaftliche Produktivität erhöhen, vor allem wenn neue Querschnittstechnologien wie Künstliche Intelligenz angewendet werden. Gleichzeitig können solche Investitionen die absehbare Verknappung des Arbeitsvolumens kompensieren.
Gut entwickelte und liquide Kapitalmärkte sind zentral, um die Wachstumsschwäche zu überwinden und die digitale und grüne Transformation zu finanzieren. Sie lenken Kapital gezielt zu hochproduktiven Unternehmen und Wirtschaftsbereichen. Kapitalmarktbasierte Finanzierung stärkt Investitionen in neue, riskantere Technologien sowie in Forschung und Entwicklung. Start-ups fördern Innovationen und tragen zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum bei. Allerdings besteht in Deutschland und anderen europäischen Ländern erheblicher Nachholbedarf bei der Finanzierung von jungen Unternehmen in der Wachstumsphase.
(Sachverständigenrat vom 08.11.2023 / Viola C. Didier, RES JURA Redaktionsbüro)