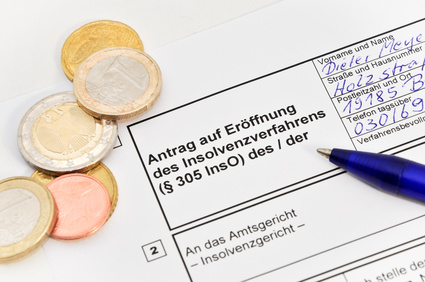Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie erhielten vor allem kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland unkompliziert Zugang zu umfangreichen staatlichen Hilfen, um die durch den Lockdown verursachten Liquiditätsengpässe zu überstehen. Dabei wurde größtenteils nach dem Gießkannenprinzip verfahren. Wie eine aktuelle Studie des ZEW Mannheim zeigt, haben die undifferenzierten Finanzhilfen dazu beigetragen, dass ein Rückstau an Unternehmensinsolvenzen entstanden ist, der sich früher oder später auflösen wird.
Die finanzielle Unterstützung gesunder Unternehmen, die durch den Lockdown unverschuldet in Schwierigkeiten geraten sind, ist laut der Studienautoren absolut nachvollziehbar, es erhielten aber auch Unternehmen staatliche Hilfe, die auch ohne den Lockdown in eine existenzielle Krise gesteuert wären. Die Dringlichkeit der Maßnahmen führte der Untersuchung zufolge zu einer undifferenzierten Herangehensweise, welche neben den direkten Kosten in Milliardenhöhe auch negative Folgen für mittelfristige Wachstumschancen und die Produktivitätsentwicklung in Deutschland haben können.
Insbesondere sehr kleine, finanziell schwache Unternehmen, die unter normalen wirtschaftlichen Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit den Weg in die Insolvenz bestritten hätten, wurden laut der Analyse ohne die Perspektive einer erfolgversprechenden Sanierung am Leben gehalten.
Welle an Unternehmensinsolvenzen erwartet
Die Hilfspakete in Milliardenhöhe in Verbindung mit der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in den Monaten nach dem ersten Lockdown werden nach Ende der Pandemie (oder auch dann, wenn sich deren Ende noch lange hinauszögert) eine Welle an Unternehmensinsolvenzen zur Folge haben – mit dann negativen Konsequenzen für die Gesamtwirtschaft. Normalerweise führen Insolvenzen dazu, dass Mitarbeiter sich auf dem Arbeitsmarkt anderen, effizienter und kreativer arbeitenden Unternehmen zuwenden und dass Kapital weg von insolventen hin zu wirtschaftlich stabilen Unternehmen fließt. Dieser Prozess stärkt auch die gesamtwirtschaftliche Produktivität und Innovationskraft und wirkt einem Fachkräftemangel bei den stabilen Unternehmen entgegen, erklären die Autoren der Studie. Allerdings werde dieser Prozess behindert, wenn auch Unternehmen, die sich unter normalen Umständen nicht aus eigener Kraft am Markt behaupten können, vor dem Konkurs bewahrt werden.
Kein Rückstau bei Unternehmen mit einer guten Vorkrisenbonität
So zeigt die ZEW-Studie, dass in den besonders von der Krise betroffenen Branchen weniger als halb so viele Unternehmen den Gang zum Insolvenzgericht angetreten haben wie auf Basis der Daten der „guten“ Vorjahre zu erwarten gewesen wären. Besonders ausgeprägt ist dieser Unterschied für Mikro-Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern, während er mit steigender Unternehmensgröße immer mehr abnimmt, so die Analyse. Laut der Studie entfällt auf diese Unternehmensgruppe, der weit überwiegende Teil der Rückstaus von ca. 25.000 Unternehmen. Weiterhin fällt in der empirischen Analyse des Insolvenzrückstaus bei Mikro-Unternehmen auf, dass dieser weitgehend auf Unternehmen zurückzuführen ist, die bereits vor der Corona-Krise finanziell schwach aufgestellt waren. Für Unternehmen mit einer guten Vorkrisenbonität lasse sich hingegen kein Rückstau beobachten. Daher sollte die Politik im weiteren Verlauf der Corona-Krise ihre Finanzhilfen für Unternehmen nach sorgfältiger Prüfung verteilen, raten die Studienautoren.
Die ZEW-Studie vergleicht die Bonität der Unternehmen im Vorkrisenzeitraum Juli 2017 bis Dezember 2019 mit dem Corona-Krisenzeitraum April bis einschließlich Juli 2020. Sie beruht auf Daten des Mannheimer Unternehmerpanels (MUP) und erfasst ca. 1,5 Mio. Unternehmen. Das MUP beruht auf einer Kooperation zwischen dem ZEW und dem Verband der Vereine Creditreform, der größten deutschen Kreditauskunftei, die Informationen zur Bonität der Unternehmen bereitstellt.
Die Studie „The COVID-19 Insolvency Gap“ in englischer Sprache finden Sie hier zum Download.
(Pressemitteilung ZEW vom 26.02.2021)