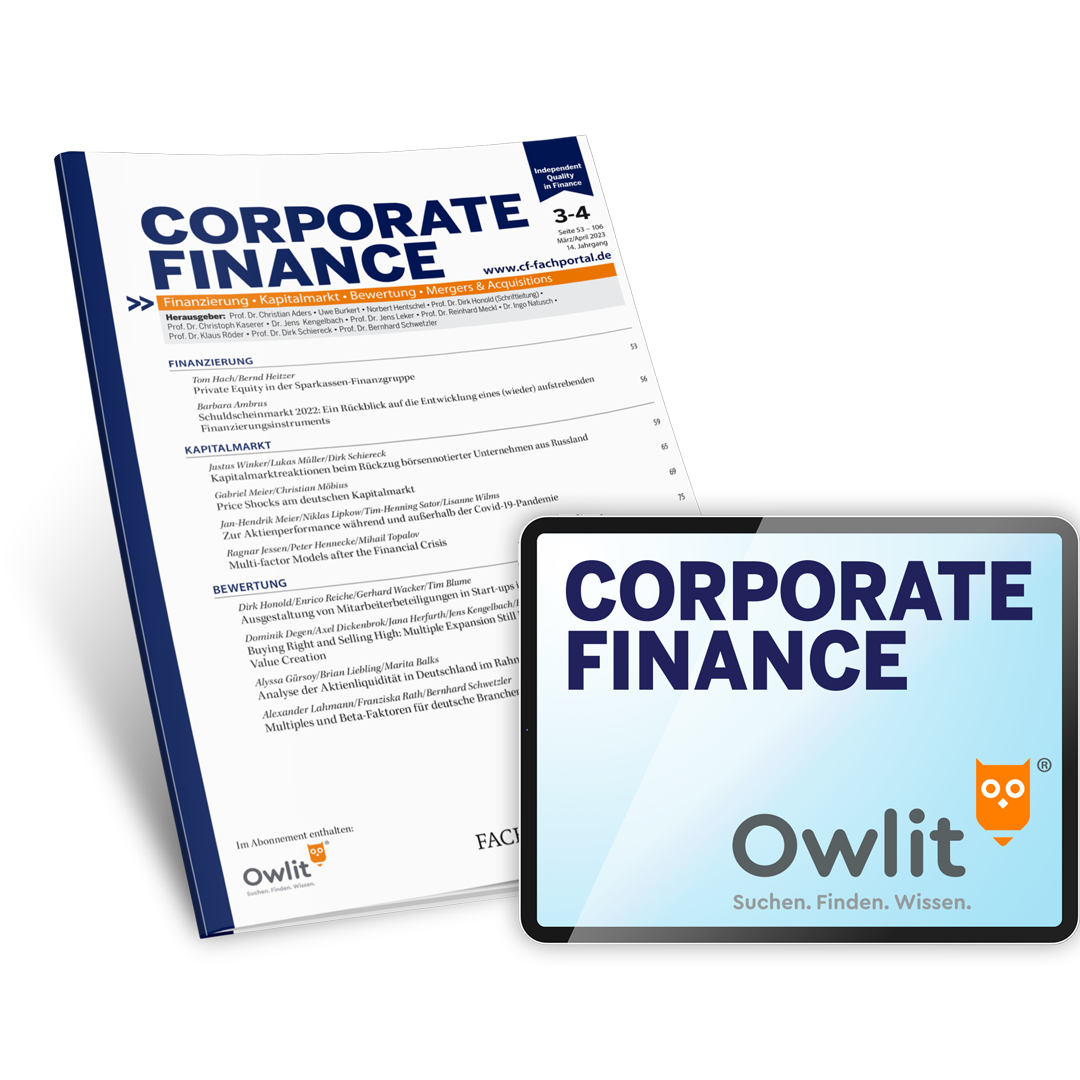Eine jährliche Dekarbonisierungsrate von 17,2 % (im Vorjahr: 15,2 %) wäre erforderlich, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Das entspricht dem Siebenfachen der im vergangenen Jahr erzielten Rate (2,5 %) – und dem Zwölffachen des globalen Durchschnitts (1,4 %) der letzten zwei Jahrzehnte. Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens rückt damit in weite Ferne, zeigt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in der diesjährigen Ausgabe ihres „Net Zero Economy Index“.
Starkes Wachstum bei erneuerbaren Energien
Gleichzeitig war im vergangenen Jahr ein sprunghafter Anstieg bei der Nutzung erneuerbarer Energien zu verzeichnen, der auf einen beschleunigten und marktgesteuerten Übergang hoffen lässt. Solarenergie verzeichnete mit 24,4 % ihr bisher größtes Wachstum, Windenergie stieg um 13,1 %. Das Wachstum der erneuerbaren Energien konzentriert sich vor allem auf Asien (insbesondere China), die USA und Europa. Mit dieser positiven Entwicklung müssen nun umfassendere Umstellungen innerhalb der Wirtschaftssektoren und Infrastrukturen sowie eine verstärkte Unterstützung der Entwicklungsländer einhergehen.
Die Dekarbonisierung schreitet in den G7- und E7-Ländern unterschiedlich schnell voran. Die G7-Länder erreichten 2022 eine Verringerung der Emissionen um 1,2 % gegenüber einem jährlichen Durchschnitt von 2,3 % seit 2019. Im Gegensatz dazu verzeichneten die E7-Länder 2022 eine Dekarbonisierungsrate von 2,8 % gegenüber einem jährlichen Durchschnitt von 1,7 % seit 2019. Zum Vergleich: In Deutschland betrug die Rate vergangenes Jahr rund 3 % und lag damit knapp über dem hiesigen Jahresdurchschnitt (2,42 %).
Erhebliche Diskrepanz zwischen Ambition und Realität
Für den Net Zero Economy Index verfolgt PwC das Wirtschaftswachstum und die energiebedingten CO2-Emissionen im Vergleich zu den Raten, die erforderlich sind, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Der Index zeigt, wie die Volkswirtschaften dabei vorankommen, die Verbindung zwischen Wirtschaftswachstum und Anstieg der energiebedingten Emissionen zu durchbrechen.
Seit dem Jahr 2000 hat kein G20-Land eine Dekarbonisierungsrate von mehr als 11 % im Jahr erreicht – den höchsten Wert erzielte das Vereinigte Königreich im Jahr 2014 (-10,9 %). Die globale Gemeinschaft muss dementsprechend jetzt handeln, um eine Chance zu haben, die vom IPCC für 2030 gesetzte Frist einer Emissionsreduzierung um 43 % einzuhalten.
(PwC vom 26.10.2023 / Viola C. Didier, RES JURA Redaktionsbüro)