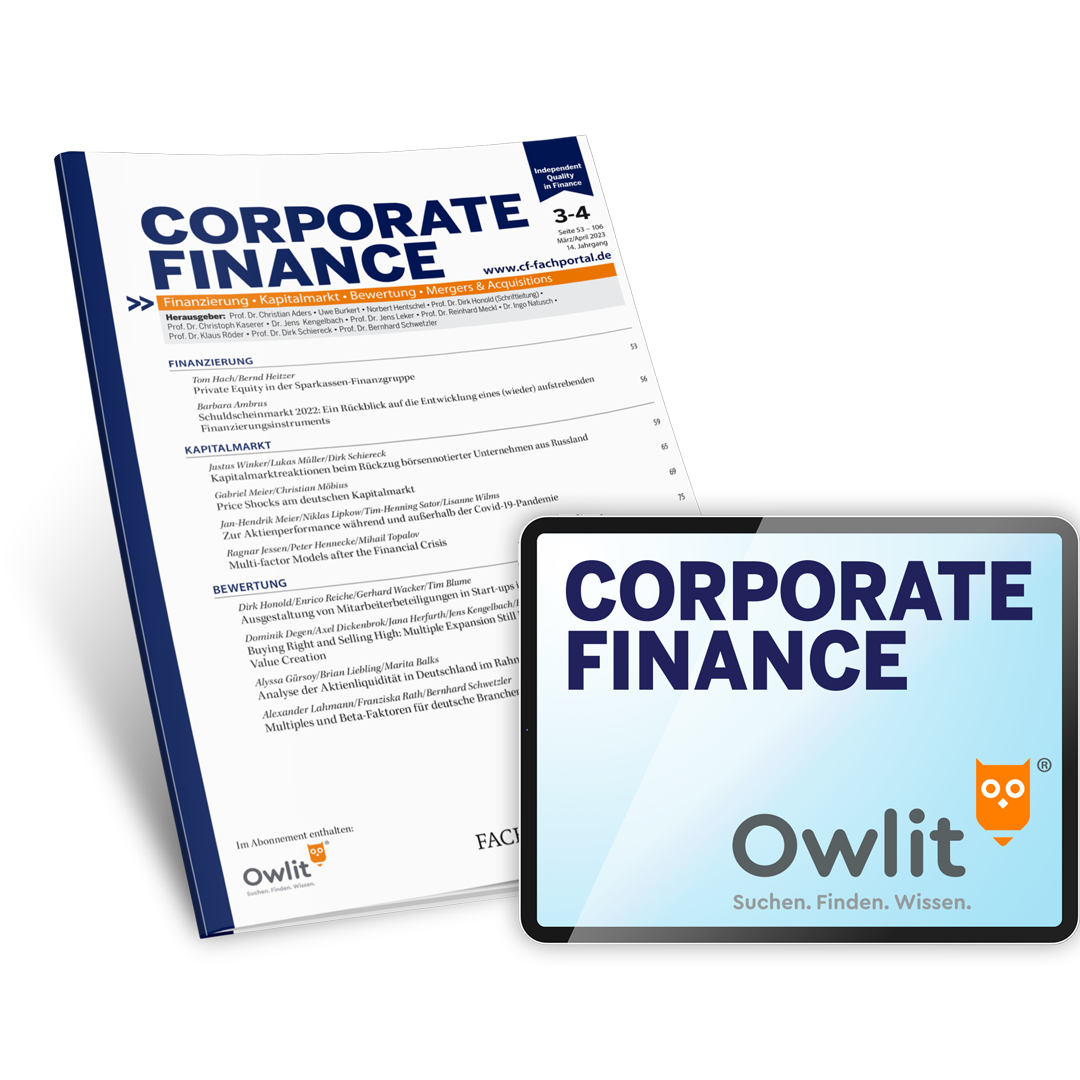Die Gründungstätigkeit in Deutschland hat 2022 einen Dämpfer erhalten, wie eine Vorabauswertung des repräsentativen KfW-Gründungsmonitors zeigt. Mit 550.000 Existenzgründungen gingen ca. 57.000 Personen weniger als 2021 den Schritt in die Selbständigkeit. Das entspricht einem Rückgang von 9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Gründungstätigkeit hat sich sowohl im Voll- als auch im Nebenerwerb verringert: Die Zahl der Vollerwerbsgründungen sank auf 222.000, das sind 14.000 (-6 %) weniger als 2021. Noch stärker ist der Rückgang bei den Nebenerwerbsgründungen, die um 43.000 auf 328.000 sanken (-12 %). Die Gründungsquote ging auf 108 Gründungen je 10.000 Menschen im Alter von 18-64 Jahren zurück (2021: 119).
Zum Gründungsgeschehen
Bei den allermeisten Existenzgründungen in Deutschland erfolgt der Schritt in die Selbstständigkeit traditionell mit einem neuen Unternehmen, das es zuvor rechtlich wie organisatorisch nicht gab. Ihr Anteil blieb 2022 mit 86 % auf seinem Rekordniveau des Vorjahrs. Die übrigen 14 % entfallen auf Unternehmensübernahmen und -beteiligungen. Angesicht der großen Zahl an mittelständischen Unternehmen, die eine Nachfolgelösung suchen, ist das eine volkswirtschaftliche Herausforderung. Ebenfalls nahezu unverändert ist der Anteil der Sologründungen – das sind Unternehmen, die von einer einzelnen Gründungsperson gegründet werden und nicht von Teams. Er lag im vergangenen Jahr bei 82 % nach 81 % im Jahr zuvor. Der Arbeitgeberanteil unter den Existenzgründungen ist dagegen von 21 auf 34 % deutlich gestiegen.
Existenzgründungen sind zentrale Treiber des Wandels
„Kaum dass sie den Corona-Knick kurzzeitig wettgemacht hatte, ist die Gründungstätigkeit in Deutschland 2022 leider schon wieder rückläufig“, sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. „Für die deutsche Volkswirtschaft sind das schlechte Nachrichten, denn Existenzgründungen sind zentrale Treiber des strukturellen und technologischen Wandels – und sie unterstützen so die Zukunftsfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft. Gerade auch mit Blick auf die grüne und die digitale Transformation braucht Deutschland neue Unternehmen mit frischen und innovativen Ideen. Den Gründergeist wieder zu stärken bleibt somit eine elementare Herausforderung, für die alle politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteure an einem Strang ziehen müssen.“
Der neue KfW-Gründungsmonitor erscheint voraussichtlich Frühsommer 2023. Die aktuelle Vorabauswertung ist abrufbar unter www.kfw.de/kompakt
(KFW vom 04.04.2023 / Viola C. Didier, RES JURA Redaktionsbüro)